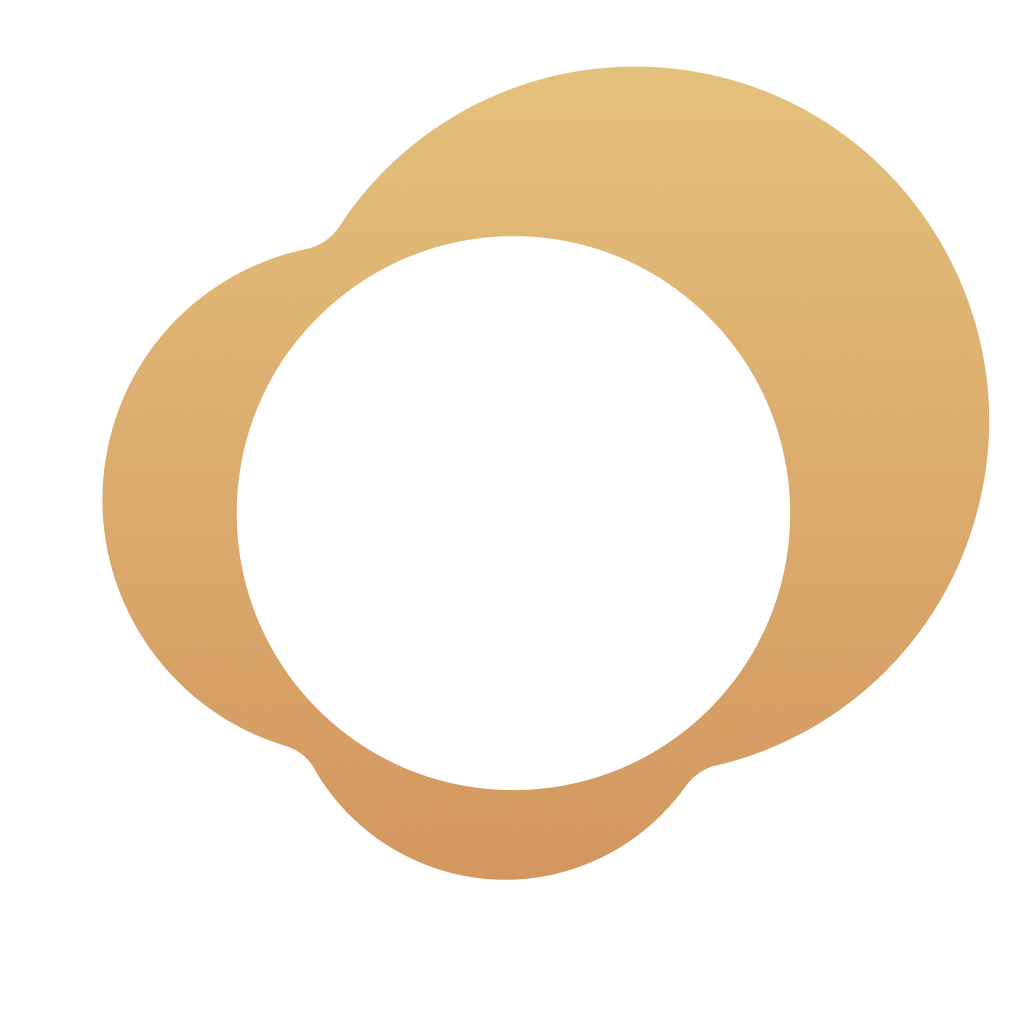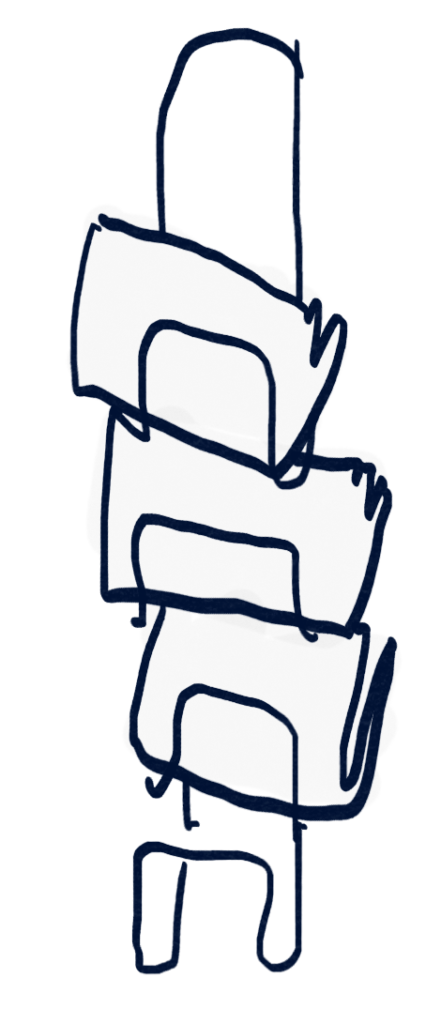«Alle erzählen der Reihe nach etwas Lustiges, das sie am Wochenende erlebt haben.»
Peinliches Schweigen, verlegenes Kichern, vielsagendes Augenrollen.
Ein Meeting-Anfang im Arbeitskontext, der Verbindung schaffen soll, ist mittlerweile nicht mehr ganz ungewöhnlich. Diese Praktik kann – wie so vieles – auf verschiedenste Art und Weise durchgeführt werden.
Das Check-in als moderierter Start eines Meetings wird an verschiedenen Stellen in der Welt der modernen, kollaborativen Arbeitsformen beschrieben.
Guter Anfang – gutes Meeting
Warum braucht es einen speziellen Anfang, um ein Meeting besser zu machen?
Versetzen wir uns einmal kurz in ein normales Meeting, eines der Art, in das alle inhaltlich irgendwie hineinstolpern und dessen Ende alle herbeisehnen. Vielleicht ist es langweilig, vielleicht sagt niemand etwas, vielleicht alle aufs Mal, vielleicht fühlst du dich am falschen Ort oder vielleicht entwickelt es eine Dynamik, die nicht der gemeinsamen Zielerreichung oder Entscheidfindung dient, sondern der Profilierung.
Wir haben uns leider an diese Art Meetings gewöhnt. Was könnte also anders sein?
Weil alle Teilnehmenden eines Meetings aus ihrem eigenen vorangegangenen Kontext kommen, braucht es für alle eine kleine Anlaufzeit, um im neuen, gemeinsamen Kontext anzukommen. Egal, ob das in einem physischen Raum oder per Videocall ist.
Dieses Ankommen ist durchaus vergleichbar mit dem kurzen persönlichen Moment, den man sich nimmt, bevor man in einem Saal voller Publikum ein Referat beginnt. Mit Atem, mit Verbindung, mit Fokus. Mit einem Ritual.
Was den Check-in wertvoll macht
Die Praxis des Check-ins hat mehrere nützliche Vorteile, benötigt wenig Zeit und kennt verschiedene Varianten, auf die ich nachher eingehen werde.
- Jede:r hat die Stimme ein erstes Mal benutzt
- Allen wurde ein erstes Mal zugehört
- Die Themen, Gedanken und Gefühle, die nicht zum Meeting gehören, können einfach deponiert und somit draussen gelassen werden.
- Jede:r wird sich über den eigenen Zustand vielleicht überhaupt erst einmal bewusst.
- Falls nötig, wissen die anderen über ein mentales oder emotionales Hindernis Bescheid, das mich gerade blockiert.
- Alle wählen ihre eigene Tiefe, die für sie in diesem Kontext und Moment passt. Je tiefer das Team eincheckt, desto besser wird das Meeting.
- Durch das Aussprechen des «Hier-seins» werden alle präsent und für das Meeting fokussiert.
- Das Aussprechen des «Hier-seins» ist eine Selbstverpflichtung zur Präsenz.
- Alle dürfen aussprechen, was ihre Aufmerksamkeit in diesem Moment wegzieht und was ihnen helfen kann, dennoch hier und jetzt präsent zu sein
- Es wird eine kollektive zeitliche Pufferzone zu allen unmittelbar vorangegangenen individuellen Erlebnissen geschaffen.
Ein Team- oder Gruppen-Check-in wird gemeinsam in der Gruppe gemacht. Bei grossen Gruppen kann es sinnvoll sein, diese Praxis in kleineren Gruppen oder je zu zweit mit einigen Wiederholungen zu machen.
Den Check-in moderieren
Es ist hilfreich, eine Person zu haben, die ein Meeting moderiert und die bezüglich dieses Anfangs klare Anweisungen und Fragen gibt. Einige wichtige Details der Anleitung sind:
- In Runden sprechen, nacheinander.
- Alle hören zu
- Niemand nimmt Bezug auf etwas, das gesagt wurde, weder inhaltlich noch durch Mimik oder Körpersprache. (Ausnahme: Willkommen, siehe unten)
- Wenn du nichts preisgeben willst, sprich zumindest aus, dass du jetzt dabei bist.
- Wenn du dich ausserstande fühlst, einzuchecken, tu es nicht und nimm konsequenterweise auch nicht an dem Meeting teil.
Gute Moderation und Verständnis für Formen der Zusammenarbeit kann man lernen
Andere Methoden, andere Sitten
Die Praxis des Check-ins wird in verschiedenen Varianten beschrieben.
Sociocracy 3.0 (S3) beschreibt das Muster des Check-in so: Der Check-in ist eine kurze Mitteilung darüber, wie es dir im Moment geht, die den anderen einen Einblick in deine Gedanken, Gefühle oder Bedürfnisse ermöglicht.
Das Check-in Protokoll ist auch ein Bestandteil der Core Protokolle, einer Sammlung von nützlichen Kommunikationsabmachungen zwischen Menschen. Diese Variante erlaubt nur die Auswahl und Kombination aus den vier Gefühlszuständen traurig, glücklich, ängstlich, wütend (mad, sad, glad, afraid).
Jede dieser Äusserungen, auf Englisch manchmal «disclosure» (Bekanntgabe) genannt, wird mit einem formelhaften Dabei-sein-Code abgeschlossen, z. B. «Check-in!», «Ich bin eingecheckt!» oder «Ich bin dabei!»
Willkommen!
In einigen der Praktiken heissen die anderen Teilnehmenden jede:n nach ihrem:seinem Check-in willkommen. Mir gefällt dieses Willkommenheissen, und ich anerkenne, dass Menschen sich anfänglich daran stören. Kann man, muss man aber nicht.
Check-in und Fragen
Im Internet finden sich unzählige Listen und «Generatoren» origineller «Check-in Fragen». Damit lässt sich ein auflockernder Einstieg in den Workshop schaffen. Das ist nicht falsch, aber eben kein Check-in. Wenn es sich ungewohnt anfühlt, sich zu Beginn einer Besprechung reihum mitzuteilen, kann eine Gruppe durch diesen spielerischen Zugang an die Praxis des Check-ins herangeführt werden.
Wichtig ist:
- das Check-in findet regelmässig statt
- der Zweck der Präsenz und Fokussierung wird erreicht
- es findet keine Ablenkung durch eine ungünstige Fragestellung statt
- das Check-in benötigt nicht zu viel der zur Verfügung stehenden Zeit
- Ein Check-in in einer Gruppe ist nicht dasselbe wie ein Icebreaker (eine kurze Aufwärm-Aktivität für die Gruppe). Icebreaker sind auch nützlich, haben aber einen vollkommen anderen Zweck